Designing With the Mind in Mind
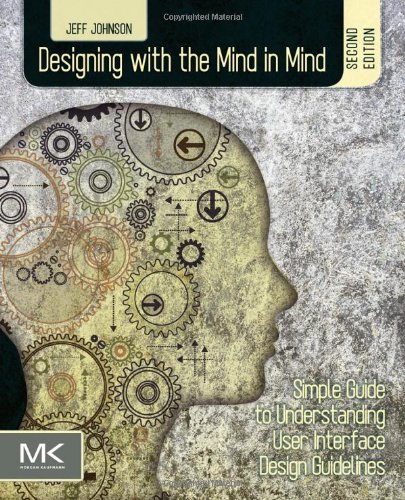
 Wer gute Produkte gestalten will, der muss deren Nutzer kennen. Das ist jedem klar, der im Bereich der UX arbeitet, und doch ist das in der Praxis nicht immer ganz so einfach – etwas Theorie kann also nie schaden. Und auch wenn man seine Erfahrungswerte mit Argumenten untermauern möchte, hilft ein solides Grundwissen in Psychologie. Denn die Psychologie beschreibt unter anderem, wie alle Menschen auf Dinge reagieren, wie ihre Wahrnehmung und ihr Gedächtnis funktioniert.
Wer gute Produkte gestalten will, der muss deren Nutzer kennen. Das ist jedem klar, der im Bereich der UX arbeitet, und doch ist das in der Praxis nicht immer ganz so einfach – etwas Theorie kann also nie schaden. Und auch wenn man seine Erfahrungswerte mit Argumenten untermauern möchte, hilft ein solides Grundwissen in Psychologie. Denn die Psychologie beschreibt unter anderem, wie alle Menschen auf Dinge reagieren, wie ihre Wahrnehmung und ihr Gedächtnis funktioniert.
Wer dieses Psychologie-Grundwissen nicht durch ein Studium hat, dem sei das Buch “Designing With the Mind in Mind” ans Herz gelegt.
UI bzw. UX hat seine Wurzeln in der Kognitionspsychologie, viele ihrer Wegbereiter waren Psychologen. Heute sind Psychologen hier in der Minderzahl und man findet viele Designer, Informatiker, Wirtschaftswissenschaftler, ja sogar Soziologen, Biologen und Journalisten. Für alle diese lohnt sich eine Mini-Fortbildung in Psychologie.
Die Abbildungen sind stets praxisrelevant und verdeutlichen gut die angesprochenen Konzepte. Einige von ihnen wirken jedoch wie aus den 1990er-Jahren – was inhaltlich unproblematisch ist, das visuelle Vergnügen aber etwas schmälert. Das hätte man im Rahmen der 2. Auflage ändern können. Das nur als kleiner Kritikpunkt vorab.
Der Aufbau
Das Buch ist keine Einführung in die Psychologie. Es beschreibt nur, was für alle wichtig ist, die im Bereich User Experience, Interface Design und Usability arbeiten. Und das immer auf die Praxis bezogen, mit vielen anschaulichen Beispielen. Diese kommen meist aus dem Web, Geräte sieht man kaum.
In den ersten Kapiteln geht es vor allem um die visuelle menschliche Wahrnehmung. Also um die Wahrnehmung von Formen/Strukturen, Mustern, Anordnungen und Farbe (u.a. Gestaltpsychologie).
Ein eigenes Kapitel beschäftigt sich mit Text und Lesen.
In den nächsten Abschnitten geht es vor allem um Gedächtnis und Lernen.
Es folgen Kapitel über Entscheidungsfindung, über Hand-Auge-Koordination und über unser Zeitempfinden.
Der Ansatz
Der Autor Jeff Johnson hat einen angenehm pragmatischen Ansatz. Er schreibt:
Die Regeln für die Interface-Gestaltung sind weniger Kochrezepte, die man einfach Schritt für Schritt nachvollzieht. Sie sind mehr wie Gesetze, die von Anwälten und Richtern interpretiert und von Fall zu Fall möglichst passend ausgelegt werden.
Beispiele aus dem Inhalt
Im Folgenden einige Beispiele für Ideen, die das Buch vermittelt.
Wir sind nicht fürs Lesen geschaffen
Lesen ist unnatürlich. Jeder Mensch bringt bei der Geburt eine Grundausstattung mit, die es ihm erlaubt, schnell und recht mühelos sprechen zu lernen. Aber mit dem Lesen ist es anders.
Lesen bedeutet also immer Anstrengung. Und wir sind darauf programmiert, Anstrengung möglichst zu vermeiden. Daher ist es so wichtig, Text ganz bewusst einzusetzen, ihn kurz zu halten, ihn zu gliedern und ihn auf Nutzer und Nutzungssituation hin abzustimmen.
Ein Beispiel dafür, wie der Autor mit Mythen aufräumt:
Wörter in GROSSBUCHSTABEN sind schlechter lesbar. Und das sind sie, weil wir nicht gewöhnt sind, sie zu lesen. Um zehn bis fünfzehn Prozent sinkt die Lesegeschwindigkeit bei Text ganz in Großbuchstaben.
Anders als in vielen Typografie-Büchern und alten Psychologiebüchern zu lesen, erkennen wir Wörter nicht anhand ihrer Form, sondern wir lesen tatsächlich die einzelnen Buchstaben und kombinieren daraus unbewusst die Wörter, die diese bilden.
Die Schlussfolgerung ist die Gleiche: Vermeiden Sie Wörter ganz in Großbuchstaben. Aber Sie sparen sich die Blamage vor Psychologen im Team oder auf Kundenseite, wenn Sie den richtigen Grund hierfür kennen.
Arbeitsgedächtnis und GUI
Eine Standard-Richtline für Menüs ist die “Sieben plus minus 2-Regel”: Verwende am besten sieben Menüelemente. Aber auf jeden Fall nicht mehr als neun (7+2) und nicht weniger als fünf (7–2).
Diese Regel hat sich zwar bewährt, doch fußt sie auf einem veralteten Konzept: Die Regel hatte der Psychologe George Miller 1956 postuliert. Sie besagt, dass unser Arbeitsgedächtnis um die sieben einzelne Elemente speichern kann.
Das war in dieser Form von Anfang an problematisch, weil unklar war, was ein einzelnes Element definiert und wie eng oder unabhängig diese voneinander sein sollten.
Schon das “plus-minus zwei” deutete an, dass die genaue Zahl variabel ist. Sie hängt von den Elementen genauso ab wie von den einzelnen Personen.
In den 1960 und 70er Jahren wurde klar, dass der Wert eigentlich zu hoch ist. Vier plus minus eins wurde als ein realistischer Wert festgestellt.
Heute sind Psychologen vorsichtig, solche plakativen Regeln aufzustellen. Johnsons Fazit: Wie viel unser Arbeitsgedächtnis gut im Zugriff behalten kann, ist noch nicht abschließend wissenschaftlich geklärt.
Strukturierung hilft
Um die Aufnahme von Informationen zu erleichtern sollten wir alles so gut wie möglich strukturieren. Das gilt z.B. für die Gliederung von langen Zahlenreihen wie Telefonnummern.
Sehr schlecht aufzunehmen ist z.B.:
0049897858321
Besser ist eine solche Gliederung, die von vielen so auch gleich als Telefonnummer erkannt wird:
0049 +89 / 785 83 21
Eingabeformulare sollten demnach auch die Gliederung erlauben. Das reduziert Eingabefehler und schafft die Möglichkeit, die Eingabe leicht zu überprüfen. Leerzeichen, Bindestriche oder Klammern bei Telefonnummern sollte ein Formular also immer erlauben und die Programmlogik sollte diese vor der Übergabe an eine Datenbank o.Ä. entfernen.
An einer Stelle muss ich Jeff Johnson deutlich widersprechen: Er empfiehlt, zusammenhängende Elemente auf mehrere Felder aufzuteilen. Eine E-Mail-Adresse möchte er in zwei Feldern eingeben lassen: Eines für den Teil vor dem @-Zeichen, eines für den Teil hinter dem @-Zeichen.
Das allein kommt mir seltsam vor – zudem ist es mittlerweile vollkommen unüblich, so ein Formular habe ich seit Jahren nicht mehr im Web oder bei einem Nutzertest gesehen. Und dann auch noch ein Popup-Menü für die Domain (.de, .com …) zu verwenden, erscheint mir persönlich abwegig und extrem mühsam zu benutzen.
Wir entscheiden selten rational
Wieder ganz bei dem Autor bin ich im Kapitel über Entscheidungsfindung.
Wir gehen meistens davon aus, dass wir rationale Entscheidungen fällen. Das tun auch die Ökonomen. Aber Psychologen wissen, dass die meisten unserer Entscheidungen zumindest einen irrationalen Anteil haben. Wir entscheiden viel mehr aus dem Bauch, als uns selbst bewusst ist.
Johnson stellt das “System 1” und das “System 2” vor – ein Konzept, das der Nobelpreisträger Daniel Kahneman popularisiert hat – und von dem einige wohl schon gehört haben.
System 1 ist der Teil unseres Gehirns, der entwicklungsgeschichtlich älter ist und für schnelle, meist unbewusste Entscheidungen sorgt. Es hilft uns in Gefahrensituationen, bringt aber auch scheinbar irrationale Entscheidungen, Vorurteile und andere Probleme mit sich.
System 2 ist dagegen, verkürzt gesagt, unser logisches Denken.
Doch das System 1 ist kein Dämon, der uns zu schlechten Entscheidungen treibt. Vielmehr ist es ein Mechanismus, der sich in der Evolution herausgebildet hat und uns geholfen hat, zu überleben. In der Geschichte der Menschheit war es lange Zeit lebenswichtig, innerhalb kürzester Zeit zu entscheiden, ob ein Sinneseindruck eine Gefahr bedeutet und wir besser die Beine in die Hand nehmen sollten – oder ob dieser Sinneseindruck das Zeichen einer lohnenden Beute ist, die wir uns sichern sollten.
Die Zeit spielt eine wichtige Rolle
Johnson schreibt:
In den letzten fünf Jahrzehnten haben Forscher immer wieder festgestellt, dass die Responsivität eines interaktiven Systems – also die Art und Weise, wie es die Nutzer über seinen Status informiert und sie nicht warten lässt – der wichtigste Faktor für die Zufriedenheit mit dem System ist. Die Responsivität ist nicht einer der wichtigsten Faktoren, sie ist der wichtigste.
Deshalb hat der Autor der Reaktionsgeschwindigkeit ein eigenes, lohnendes Kapitel gewidmet.
Er beschreibt, wie man trotz langsamer oder unzuverlässiger Verbindungen oder langen Rechenzeiten dennoch hohe Responsivität erreicht:
- Indem man dem Nutzer immer klar zeigt, was das System gerade macht,
- indem man die Aufgaben so einteilt, dass die Zeiten, in denen das System auf dem Nutzer wartet, für Hintergrundaktivitäten genutzt werden oder
- indem man dem Nutzer etwas zu tun gibt, wenn Hintergrundaktivitäten laufen müssen.
Fazit
Auch wenn man schon viele Jahre im Bereich UX arbeitet, lohnt die Lektüre dieses Buches. Man lernt vielleicht nicht viel Neues in Bezug auf Lösungsansätze für UI-/Konzeptions-Probleme. Aber man lernt viele interessante Hintergründe, die einem helfen, bestehende Regeln zu hinterfragen, eigene Erfahrungen zu prüfen und Entscheidungen fundiert zu begründen. Und das Buch ruft dem Leser einige wichtige Details in Erinnerung, die man in der täglichen Praxis vielleicht bei seinen aktuellen Projekten aus dem Auge verloren hat.

